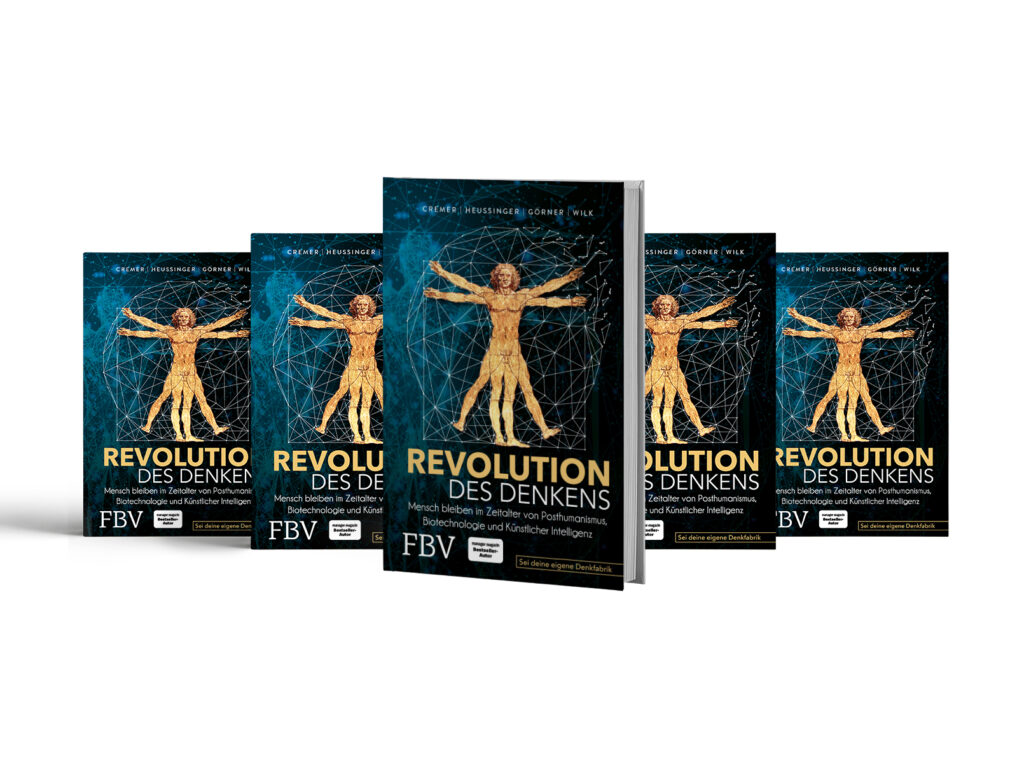In Kapitel 8 »Ewiges Leben: Ist der Mensch eine unsterbliche Maschine?« wird der Frage nachgegangen, ob der Mensch eine »unsterbliche Maschine« werden könnte und was es generell mit dem ewigen Leben auf sich hat. Bereits vor über 150 Jahren kam Goethe in der Erstausgabe von Nature – heute eine der einflussreichsten Zeitschriften im Bereich der Naturwissenschaften – als hochberühmter Naturforscher zu Wort. Eine der dabei enthaltenen Maximen sagt, die Natur sei »ewiges Leben, Bewegung und Entwicklung«, und eine andere: »Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben«. In der heutigen Zeit, die geprägt ist durch den Jugendlichkeitskult der modernen Gesellschaft und die Tendenz, den Tod zu verdrängen, erscheint diese fast positive, jedenfalls gelassen wirkende Einstellung zum Tod sehr merkwürdig. Weder wollen wir an die Endlichkeit des Lebens erinnert werden noch sind wir bereit, sie anzuerkennen, und wir entwickeln mit- unter absurde Fluchtmechanismen. Die Kenntnis über den Tod gehört aber zum Erwachsenwerden dazu. Heute wissen wir dank der modernen Strukturbiologie, dass eines der wesentlichen Geheimnisse des Lebens tatsächlich die fast kristalline Ordnung der einzelnen Moleküle, Makromoleküle und der aus ihnen gebildeten »biomolekularen Maschinen« ist. Die höchst verwickelten und höchst dynamischen Lebensvorgänge, die sich aus der Interaktion der Moleküle im Inneren der Zellen und zwischen den Zellen eines Organismus ergeben, sind das große Zukunftsthema der Biowissenschaften des 21. Jahrhunderts, der »Systembiologie«. Derzeit beginnt in den Lebenswissenschaften diese Erweiterung vom Molekül zum System, vom Kristall zum Menschen, vom Teil zum Ganzen. Auf diese Weise wird es möglich werden, unser Wissen von den Molekülen und den vielfältigen biochemischen Reaktionen in ein geistiges Bild der materiellen Grundlagen des Lebens zu integrieren.
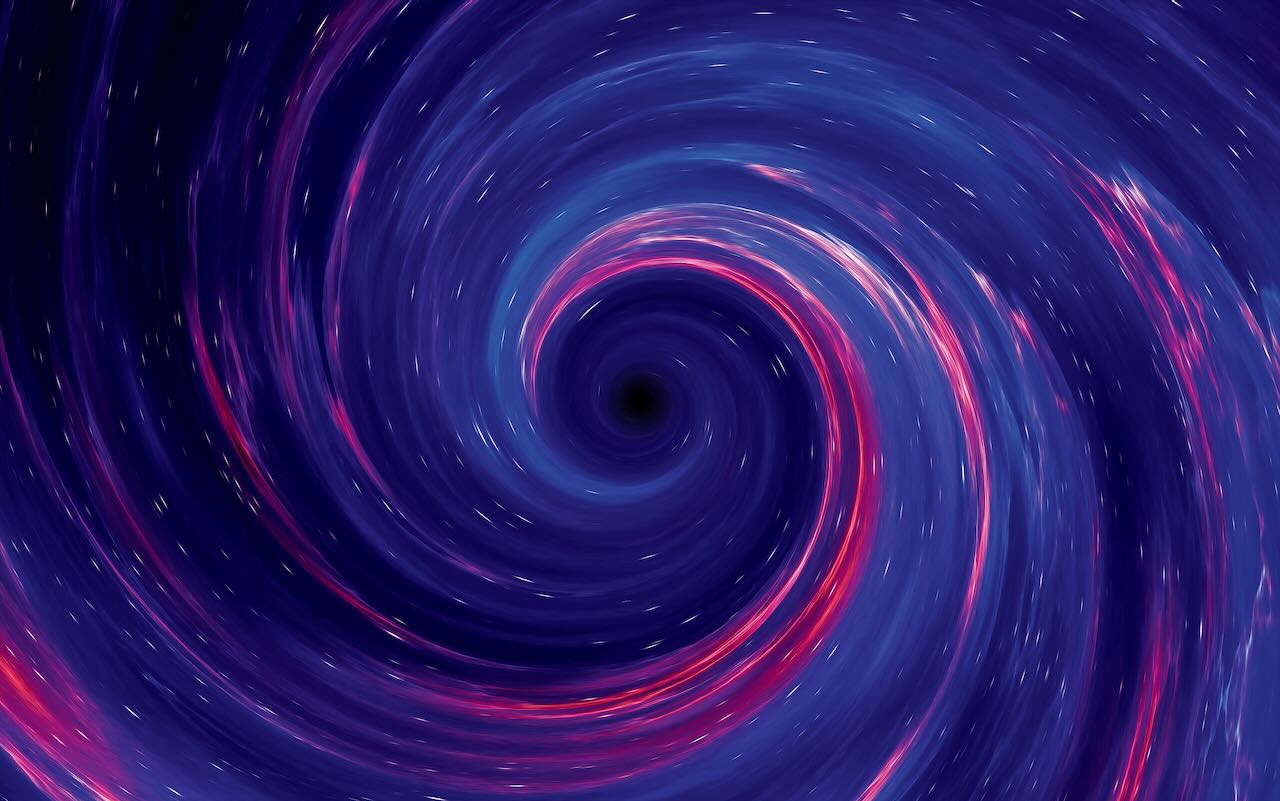
»Die Natur ist ewiges Leben, Bewegung und Entwicklung. Leben ist ihre schönste Erfindung, und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben.«
(S. 202, Goethe-Zitat)